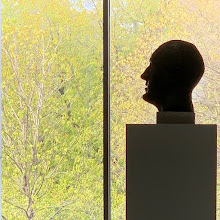El enemigo más solapado es la actualidad
René Char
La
primera vez que nos citamos para conversar en un café, solos, al poco de
conocernos dentro del grupo excursionista del barrio, y aún sin ninguna
perspectiva de noviazgo, al menos por mi parte, me lo contó. Nos sentamos en
una mesa de mármol, redonda, más bien escasa, donde apenas existía espacio para
las dos tazas vacías y las dos teteras con las infusiones que habíamos pedido.
De la mía no me acuerdo, pero en la suya humeaba un té verde, una bebida que me
pareció muy adecuada para la ocasión. Me temo que la mía fuera un poco más
prosaica. Una manzanilla o un poleo, tal vez. La tarde, debió de ser en mayo o
en junio, era ya capaz de estirarse casi lo que se le pidiera, en plena
adolescencia del año climático. Se había puesto una camisa clara y la chaqueta
de punto la había dejado sobre el respaldo de la silla, bien puesta. No consigo
recordar, sin embargo, si aquel día elegí una falda o recurrí al pantalón de
diario. Lo cierto es que hasta después de que me lo contara no había despertado
en mí aquel chico ningún tipo de interés.
No sabría decir desde qué momento
fuimos novios. En las películas había visto que eso se pide e incluso se
celebra la petición en el calendario. No es que lo esperara y me quedase
esperándolo, en absoluto, me gustó ese ir construyendo la relación día a día. Y
al vernos, presentir que el beso de la víspera daría un paso al frente, aunque
ignoraba aún cuál sería. Esa incertidumbre dejaba sobre la pequeña hoguera
encendida gruesos troncos de árbol seco. Así que, sin decírnoslo, un día ya
éramos novios y caminábamos por la calle de la mano. Y los domingos por la
tarde íbamos juntos a un tipo de local que desconocía. Lugares muy tranquilos,
en calles laterales, donde nunca había entrado, claro, porque solo acudían
parejas. Atendía un único camarero, que se manejaba con una pequeña linterna.
La oscuridad era el ambiente más apreciado. Los sillones donde nos sentábamos
se daban la espalda unos a otros y la música que sonaba era dulce y
melancólica. Solo lentos, claro. Había una pequeña pista en el centro donde
habitualmente no bailaba nadie. Y sobre ese vacío, una bola de espejos que
reflejaba luces tan tenues que apenas conseguía iluminarse a sí misma. En
aquella intimidad de dos personas solas en el tiempo y en la ciudad me contaba
lo que le había ocurrido y todo lo que durante la semana se le había pasado por
la cabeza. A veces eran nimiedades, pero por trivial que pareciera lo que me
explicaba, nunca lo consideré menos significativo de la ilusionante navegación
que había emprendido nuestro noviazgo. Lo que me explicaba, allí entre sombras
y caricias, era el combustible que daba alas a nuestra aventura.
De repente, me veo una tarde de domingo
repantigada en el sofá. El televisor entretenido consigo mismo. La luz
agarrándose a los visillos para no ser engullida por el torrente de las horas.
Ya no hay excursiones, como al principio. Fue hacernos novios y abandonar
aquellas conversaciones multitudinarias en círculo alrededor de una pequeña y
humeante hoguera. Pero tampoco han sobrevivido las tardes en la cueva amorosa
de escasa luz. Desde que hemos alquilado entre los dos este cuchitril, aquella
intimidad pasó a los cajones de la memoria. Ahora nos aloja otra, menos
ensimismada. La encauzan las pantallas de todo tipo. Y aquí en el sofá
engullimos una serie, atiborrándonos a capítulos. Sobre la mesa baja, de
cristal, se acumulan las cervezas que bebemos. Incluso algunas mías, aunque
nunca he conseguido que me gusten. Los dos, en chándal. Y zapatillas. Los
primeros días compartir la vestimenta de la vida cotidiana incluso me
emocionaba. Ahora me agobia un poco, la verdad, esta ausencia de necesidad de
arreglarse durante los fines de semana.
Conforme
avanzan los meses, algunos nubarrones van cargando mi optimismo. Aunque me
negara a verlos, primero, o cuando los vi, no supiera desentrañarlos. Cuanto
hacemos en nuestro piso también es iniciativa mía y me gusta hacerlo. Me ha
costado un tiempo averiguar qué ocurre en realidad. Tras la retahíla de
episodios, me levanto y apago el televisor. Regreso al sofá. Está contento.
Habla. No es una situación desagradable, en absoluto. No sé qué está contando.
Pero siento cómo lo que sea de lo que hable me va empujando hacia mi interior,
como quien busca introducir un plástico con múltiples dobleces por el cuello de
una botella. Ahí dentro siento que me quedo y desde el interior le oigo seguir
hablando. Que si lo que está pasando allá, que si lo que dijo, fíjate, el
impresentable del ministro, que si el debate en el Parlamento, que si las
elecciones no sé dónde, que el otro día a tres paradas de metro de aquí, que si
saca un nuevo disco… como si una botella pudiera comunicarse con otra,
atravieso sus cuellos, cada vez más estrechos y yo en ellos, cada vez más sorda
y ciega. Con una sordera que no construye el silencio, sino el soliloquio inane
de las noticias en las que ni suya ni mía descubro implicada ni siquiera una
partícula de sentido.
[Cuaderno de ficciones, página 37]