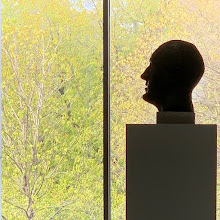Liebesminuten
der Landschaftsbeschreibung
Karl Krolow
Igual que aquel pastelito de
almendras con piñones, tradicional en alguna tradición que no consigo concretar
ahora. El que probé en una fecha lejana
y desde entonces se ha convertido en modelo de delicia, de modo que cualquier
dulce desmerece en el recuerdo. Así, mayo. No hay otro mes del año que supere su
presencia vital y cada año desaparece del calendario antes casi de que lo
sienta llegar y asentarse. Como el final de un sueño que ocupa el duermevela y
al despertar aún se puede pensar que su atractiva suplantación de la realidad
continúa. Mayo. El deshielo de los cuerpos. La chaqueta que doblo y apoyo en el
hombro de quien lleva el último saco del día al almacén. Porque mañana saldré en camisa.
Me
detendría a conversar con un tilo si fuera necesario cuando cruzo la avenida en
el mes que se me escapa mientras hablo con colegas que apenas conozco a las
puertas de la oficina o me entretiene la quiosquera del barrio con sus tesis de
sociología llenas de cursivas. Y si por inercia he salido de casa con los
guantes, estoy dispuesto a perderlos, sin preocupación alguna, del mismo modo
que los presidiarios abandonan radiantes sus pertenencias en la celda cuando el
motín abre una brecha en el muro. Y esos dedos sin funda lo palparían todo a su
paso. Está a punto de llegar incluso el día en el que, tras hacer el pino en
mitad de la acera, camine boca abajo sostenido por las palmas de la mano, solo
por ir tocando el suelo de mayo.
Alguien
ha encendido de repente y sin avisar las luces de la sala. Las acuarelas y
óleos, que la blancura de la oscuridad cegaba, brillan desde las cuatro paredes
ya sin puertas. El pintor ha dispuesto en su paleta al completo los matices del
verde, desde el amarillo de la hierba o el rojo de los brotes más tiernos hasta
el azulado de los arbustos que ocultan detrás el verde de las camisas a medio
desabotonar. El cuello y la garganta, ese recóndito lugar donde las palabras
elaboran los tonos con los que se visten o se desnudan, son moldeados ahora por
los pulgares de alfarero del aire benigno. Y la melodía suena en el pensamiento
antes de ser pronunciada.
El
cuerpo recobra su condición de materia, sobre las sábanas, con el edredón
arrugado en un extremo. En el pedregal de la piel el hábito crea sendas,
espacios apacibles donde detenerse y cerrar los ojos un instante sin sentir
temor alguno. Un territorio por fin en paz con su enemigo, el tiempo, que en
mayo parece haberse descarrilado de las vías que conducen hasta el punto,
siempre inverosímil, en el que las paralelas se unen. El cuerpo, un país recién
descubierto al que regresan sus primitivos habitantes, expatriados durante el
arduo invierno. La superficie somnolienta del lago a la que la brisa de repente
hace temblar.
Desprovistas
de gorros, bufandas o cuellos de astracán levantados, los rostros limpios
emergen en la calle como sus retratos en la cubeta del fotógrafo. El tránsito
por la ciudad se convierte en una exposición argumentada de ideas renacidas, la
que defiende cada gesto o mirada o danza de melena al caminar. Un tratado sin
doctrina detrás, huérfano de filósofo que lo enrede, cuya lectura brinda
conocimiento, aunque se desconozca la lengua en la que está escrito. Melodía
ornitológica que se impone al runrún de lo fugaz.
Es
el mes, mayo, en el que el orador alza los brazos que elevan la voz por encima
de la cabeza y quienes lo escuchan sienten la levedad de sus propios
sentimientos al levitar, cuando de repente cobran conciencia de no percibir
otra existencia que sea tan real como lo inexistente. Y quien desafíe a la
memoria, perderá todas las bazas. Porque los anales ya solo recogen los
estribillos de las baladas.
Recuerdo
los propósitos de mayo en todo lo que no he sido nunca. Y en cada una de las
páginas del libro que no he escrito. Es verdad que disponía la mesa para una celebración.
Los lápices afilados, a mano el tintero, los folios previamente agrupados, la
persiana en todo lo alto, de par en par la ventana, el sol paseando
despreocupado por las azoteas. Era tan hermoso contemplar la escritura que
escribir a continuación deshacía el encanto. Un camarero que dispone los
cubiertos y las copas sobre el mantel momentos antes que suene el teléfono
anulando la reserva. Nunca sonaba el teléfono en mayo porque lo había
descolgado. Aun así, los comensales rara vez se presentaban. Pero me ha bastado
siempre con evocar el dulzor incomparable de un pastelito de almendras con
piñones que probé en algún lugar cuya ubicación a menudo confundo.
[Cuaderno de ficciones, página 28]
Minutos amorosos
de descripción del paisaje
Karl Krolow
Genau wie dieses kleine Mandelgebäck mit Pinienkernen, gebacken
nach einer bestimmten Tradition, auf die ich jetzt gerade nicht komme. Welches
ich vor langer Zeit einmal probiert hatte und das seitdem bei mir dermaßen zu einem
Idealmodell für eine Süssigkeit geworden ist, dass kein anderes in meiner
Erinnerung dagegen ankommt. Der Mai, ebenso. Es gibt keinen
anderen Monat im Jahr, der dessen lebendige Gegenwart überträfe und der jedes
Jahr aus dem Kalender gleich wieder verschwindet, fast noch bevor ich wahrgenommen
habe, dass er kommt und dann da ist. Wie das Ende eines Traumes, der uns im
Halbschlaf in Beschlag nimmt und von dem wir auch nach dem Aufwachen durchaus erwarten
können, dass seine gelungene Nachahmung der Wirklichkeit noch nachwirkt. Mai. Das Auftauen der Körper. Die Jacke, die
ich zusammenfalte und mir über die Schulter werfe, wie jemand, der den letzten
Sack des Tages schultert, den er noch ins Lager schleppen muss. Denn morgen
werde ich ja nur im Hemd hinausgehen.
Wenn es
nötig wäre, würde ich an einem Lindenbaum stehenbleiben, um mich mit ihm zu
unterhalten, wenn ich durch die Allee gehe, in diesem Monat, der mir durch die
Finger rinnt, während ich an der Tür vor dem Büro mit Kollegen spreche, die ich
kaum kenne, oder mich noch die Frau vom Kiosk unseres Viertels aufhält, mit
ihren soziologischen Thesen voller Anführungszeichen. Und wenn ich dann doch
wieder, wie gewohnt, mit Handschuhen aus dem Haus gegangen bin, nehme ich
bedenkenlos in Kauf, sie zu verlieren, auf die gleiche Art und Weise, wie
Gefängnisinsassen freudestrahlend ihre Habseligkeiten zurücklassen, wenn sie
bei einem Ausbruchsversuch die Mauer durchbrechen. Und diese ungeschützten
Finger würden alles abtasten, auf ihrem Weg hinaus. Bald kommt der Tag, an dem,
nachdem ich mitten auf dem Gehweg einen Kopfstand gemacht habe, ich einfach im
Handstand weitergehe, nur um den Maiboden berühren zu können.
Jemand hat
plötzlich und ohne Vorwarnung das Licht im Saal angemacht. Die Aquarelle und
Ölgemälde, die vom gleißenden Weiß der Dunkelheit geblendet wurden, strahlen
von den vier Wänden zurück, schon ohne Türen. Der Maler hat alle Grüntöne auf
seiner Palette nebeneinander angeordnet, vom Gelb der Kräuter oder dem Rot der
zartesten Keime bis hin zum Blau der Sträucher, die hinter sich das Grün der
halb aufgeknöpften Hemden verbergen. Der Hals und die Kehle, dieser entlegene Platz,
wo die Wörter ihre Töne herstellen, mit denen sie sich ankleiden oder
entkleiden, werden jetzt von den Töpferdaumen der milden Luft geformt. Und ihre
Melodie erklingt in den Gedanken, noch bevor sie ausgesprochen wird.
Der Körper fällt
in seinen Status als Materie zurück, auf den Bettlaken, die Bettdecke an einem
Ende zerknittert. Auf dem steinigen Boden der Haut schafft die Gewohnheit Wege,
friedliche Orte, wo man verweilen und die Augen für einen Moment schließen
kann, ohne jegliche Angst. Ein Gebiet, schließlich, das im Reinen ist mit
seinem Feind, der Zeit, die ja im Mai aus den Gleisen gesprungen zu sein
scheint, die sie an den immer unwahrscheinlichen Punkt führen, an dem die
Parallelen aufeinander treffen. Der Körper, ein gerade neu entdecktes Land, in
das seine ehemaligen Bewohner zurückkehren, die während des rauen Winters
ausgewandert waren. Die schlaftrunkene Oberfläche des Sees, die von der Brise
plötzlich zum Erzittern gebracht wird.
Frei von
Mützen, Schals oder hochgestellten Persianerkragen, erscheinen jetzt die
sauberen Gesichter auf der Straße, wie ihre Porträts in der Entwicklungsschale
des Fotografen. Der Verkehr in der Stadt wird zu einer argumentativen
Darstellung von wiedergeborenen Ideen, die jede Geste oder jeden Blick oder den
schwungvollen Tanz der Haarmähne beim Gehen verteidigt. Eine Abhandlung ohne
Doktrin dahinter, ohne jeden Philosphen, der sie kompliziert, deren Lektüre
neue Erkenntnisse vermittelt, auch wenn man die Sprache, in der sie geschrieben
ist, gar nicht versteht. Vogelkundlerische Melodie, die gegenüber dem Gemurmel
des Vergänglichen die Oberhand gewinnt.
Es ist der
Monat, Mai, in dem der Redner seine Arme erhebt, die seine Stimme über den Kopf
steigen lassen und diejenigen, die ihm zuhören, spüren die Leichtigkeit ihrer
eigenen Gefühle, schwebend, wenn ihnen plötzlich bewusst wird, dass sie keine
andere Existenz wahrnehmen, die genauso real ist wie das, was nicht existiert. Und
wer der Erinnerung trotzt, wird all seine Trümpfe verlieren. Denn die Annalen
nehmen nur noch die Kehrreime der Balladen auf.
Ich
erinnere mich an die guten Vorsätze im Mai, bei allem, was ich nie gewesen bin.
Und auf jeder einzelnen der Seiten des Buches, das ich nie geschrieben habe. Es
stimmt zwar, dass ich den Tisch schon für eine Feier gedeckt hatte. Die
Bleistifte gespitzt, das Tintenfass zur Hand, die zuvor sortierten Blätter, die
Rollläden ganz hochgezogen, das Fenster sperrangelweit offen, die Sonne, die unbeschwert
über die Dächer flaniert. Es war so schön, das Schreiben an sich zu betrachten,
dass danach beim Schreiben selbst der Zauber verflog. Ein Kellner deckt den Tisch,
das Besteck und die Gläser sind schon auf der Tischdecke, einen Moment bevor
das Telefon klingelt und die Tischreservierung storniert. Nie klingelte das
Telefon im Mai, denn er hatte den Hörer daneben gelegt. Doch selbst so kamen
kaum Gäste. Aber es hat mir immer gereicht, mir die unvergleichliche Süße eines
kleinen Mandelgebäcks mit Pinienkernen ins Gedächtnis zu rufen, das ich einmal
an einem Ort probiert habe, dessen Lage ich oft mit anderen verwechsle.
Übersetzung aus dem Spanischen – Peter Burfeid 2025